All posts under kontrolle
Rücken-Fitnesstracker: 8sense sorgt für bessere Haltung
Das Internet versetzt uns zurück ins Mittelalter
Datenschutz: Nach wie vor von Bedeutung
Wie Kinder lügen lernen
Länderregeln: Das ‚Splinternet‘ ist vielleicht die Zukunft des Internets
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
Mein Smartphone und Ich: Digitale Trennungsangst in der postmodernen Welt
Die Kritik am BND-Gesetz ist mehr als begründet
Res publica statt geheimer Kabinettspolitik – CETA und TTIP schaden dem Gedanken der Republik
Eco klagt gegen den BND
Deutschland braucht weiterhin ein starkes Datenschutz-Gesetz
Die Cyberwar-Doku „Zero Days“ kündigt den dritten Weltkrieg an
Mit Möwen zur Drohnenroute
Mit einem Schatten in der Birne misslingt die digitale Transformation
Warum selbstfahrende Autos trotzdem menschliche Kontrolle benötigen
Gefangen im Zeitparadoxon: Wieso Warten so lange dauert
Übertrieben oder notwendig? Frankreich will E-Mails nach Feierabend abschaffen.
Wie unsere Gadgets jeden unserer Schritte überwachen
Machen unsere Smartphones uns zu ADHS-lern?
Objekte mit Gedanken kontrollieren – bald kein SciFi mehr?
Whistleblower und Leak-Aktivisten im Kampf um die Informationskontrolle
Wer nur abnickt, haftet – Über die Kontrollpflichten der Aufsichtsräte
Straßen, die Elektroautos laden, sind Teil der neuen Automobilwelt
Kinder mit Smartphone: Gefahren und Nutzen
Wie mein Smartphone mein Leben kontrolliert
5 Lesetipps für den 17. Februar
In unseren Lesetipps geht es heute um die Carbanak Hacker-Gruppe, Youtube, Abmahnungen, @meta_bene und den BR und seine Probleme mit dem Lizenzrecht. Ergänzungen erwünscht. CARBANAK SPIEGEL ONLINE: So gelang den Cybergangstern der Milliarden-Coup: Die Beute: eine Milliarde Dollar. Der Ort des Verbrechens: 100 Geldinstitute in 30 Ländern. Fluchtfahrzeug: das Internet. Am Wochenende[…]
Vertrauen versus Kontrolle
Der „Chilling Effect“: Massenüberwachung zeigt soziale Folgen
Selbstzensur, Konformität und Stress: In Überwachungssituationen wie mit der Vorratsdatenspeicherung (VDS) verändern Menschen ihr Verhalten, wie Studien zeigen. Seit etwas mehr als einem Jahr sorgt die Vorratsdatenspeicherung (VDS) für die verdachtslose Überwachung von privater digitaler Kommunikation in Österreich, seit fast einem Jahr wissen wir dank Edward Snowden von der umfassenden[…]
Apps der nächsten Generation müssen Informationsvielfalt schützen
Internet der Dinge: Die Black Box in unserem Zuhause
Unser vernetzter Alltag basiert auf Technologie, die wir nicht durchschauen und der wir nicht vertrauen (können) – besonders beim Internet der Dinge. Vor ein paar Tagen kamen meine Kollegin und ich gut gelaunt zurück aus der Mittagspause, als unsere Unterhaltung durch ein entsetztes „oh nein“ ihrerseits unterbrochen wurde. Sie hatte[…]
Buffer App: Leichteres Teilen auf Social-Media-Plattformen
5 Lesetipps für den 20. Juni
In unseren erlesenen Lesetipps geht es heute um durch Algorithmen gesteuerte Sicherheit, den Zustand des Echtzeit-Journalismus, ein Interview mit Steve Jobs, Forschung am Holo-Deck und Twitters neuerster Einkauf Spindle. Ergänzungen erwünscht. ALGORITHMUS Zeit Online: Für Algorithmen ist jeder verdächtig: Wer nichts zu verbergen hat, muss nichts befürchten? Eine Lüge. Wenn Behörden[…]
Die Rolle des Staates im Internet: Grenzwächter des Internets
Welche Rolle hat Papa Staat im Internet? Autoritäre Staaten wie China und Russland versuchen mit aller Macht, in den Cyberspace einzugreifen. Ausgerechnet der Arabische Frühling ist Auslöser für neue Regulierungsvorstöße. In großen und kleinen Dingen des Lebens gibt es anscheinend die Sehnsucht nach Kontrollen, Grenzen, Sicherheit und autoritärem Gehabe. Nur[…]
Follower-Horror oder Systemfehler?
Nun ist es also passiert. All diejenigen, die ihr Geld damit verdienen, dass ihnen Tausende und Abertausende unter anderem bei Google+ folgen, haben anläßlich eines veritablen Fehlers rund um das neue Google Events eine neue Erkenntnis gehabt. Das Verbinden von Google+ mit allen anderen Google-Diensten birgt Schadpotenzial.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – vom Datenschutz im Alltag
Dem Datenschutz wird mehr und mehr eine wachsende Bedeutung zugesagt. Durch eine immer stärker vernetzter werdende Welt und der steigenden Kommerzialisierung des Webs begibt sich inzwischen nämlich jeder zweite Bundesbürger regelmäßig ins Internet, um Informationen zu suchen, einzukaufen oder seine Kontakte auf einem der zahlreichen sozialen Netzwerke zu pflegen. Klar[…]
Vorschlag: Den Longtail verbieten
Sehr schön! Endlich hat mal jemand den Mut, das ganz große Ding zu starten. Nach Zensursula und Vorratsdatenspeicherung schnippt nun die Junge Union in NRW mit wilden Forderungen um Aufmerksamkeit. Laut einem Bericht auf DerWesten will die JU NRW eine stärkere Kontrolle von Videoportalen wie YouTube oder MyVideo. Ein Vorschlag:[…]

![Internet (adapted) (Image by Glenn Carstens-Peters) via Unsplash [CC0 Public Domain]](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/11/Internet-adapted-Image-by-Glenn-Carstens-Peters-via-Unsplash-CC0-Public-Domain-500x350.jpg)
![Rücken (adapted)(Image by whitesession [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/10/Rücken-adaptedImage-by-whitesession-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)
![Ritter (adapted) (Image by NadineDoerle [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/09/Ritter-adapted-Image-by-NadineDoerle-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)

![Kind (adapted) (image by RondellMelling [CC0] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/08/Kind-adapted-image-by-RondellMelling-CC0-via-pixabay-1-500x350.jpg)
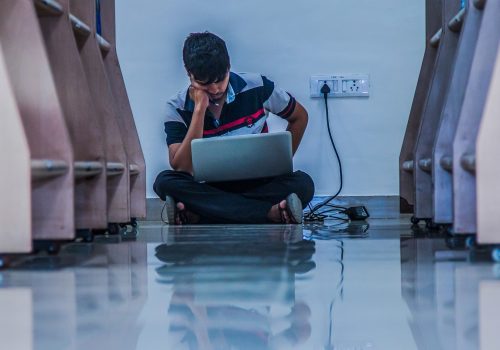


![Surveillance (adapted) (Image by Jonathan McIntosh [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/10/Surveillance-adapted-Image-by-Jonathan-McIntosh-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.png)
![Cicerón (Marcus Tullius Cicero) (adapted) (Image by sn6200 [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/10/Cicerón-Marcus-Tullius-Cicero-adapted-Image-by-sn6200-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.jpg)
![Hammer (Image by succo [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/09/Hammer-Image-by-succo-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)

![seagull (image by dyangerous [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/08/seagull-image-by-dyangerous-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)

![DRIVING IN THE MORNING (adapted) (Image by Eliecer Gallegos [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/08/DRIVING-IN-THE-MORNING-adapted-Image-by-Eliecer-Gallegos-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Backward Clock (Image by Keith Evans [CC BY SA 2.0], via geograph.org)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/07/Backward-Clock-Image-by-Keith-Evans-CC-BY-SA-2.0-via-geograph.org_-480x350.jpg)
![t was nice to have a bed after three weeks of camping. Real nice. (adapted) (Image by Jared Tarbell [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/06/It-was-nice-to-have-a-bed-after-three-weeks-of-camping.-Real-nice.-adapted-Image-by-Jared-Tarbell-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Spy (adapted) (Image by Ben Fruen [CC by 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/06/Spy-adapted-Image-by-Ben-Fruen-CC-by-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Scream! (adapted) (Image by Marcin Grabski [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/05/Scream-adapted-Image-by-Marcin-Grabski-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.png)
![13365 you're like a rubik's cube (adapted) (Image by Jin [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/05/13365-youre-like-a-rubiks-cube-adapted-Image-by-Jin-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Pfeife (image by makamuki0 [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/04/Pfeife-image-by-makamuki0-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)
![Anzüge (image by snapwiresnaps.tumblr.com [CC0 Public Domain] via Pexels)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/04/Anzüge-image-by-snapwiresnaps.tumblr.com-CC0-Public-Domain-via-Pexels-500x350.jpg)
![Park and charge (adapted) (Image by Justin Pickard [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/11/Park-and-charge-adapted-Image-by-Justin-Pickard-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Close up of smartphone in hand (adapted) (Image by Japanexperterna.se [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/11/Close-up-of-smartphone-in-hand-adapted-Image-by-Japanexperterna.se-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Two Dreamers and a Smartphone Addict (adapted) (Image by Jake Stimpson [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/11/Two-Dreamers-and-a-Smartphone-Addict-adapted-Image-by-Jake-Stimpson-CC-BY-2.0-via-Flickr-500x350.jpg)
![17 (adapted) (Image by K D [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/17-adapted-Image-by-K-D-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)
![Information has moved (adapted) (Image by John [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Information-has-moved-adapted-Image-by-John-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.png)
