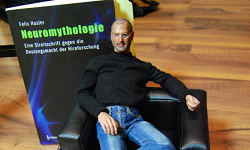All posts under Gehirn
Wie Kinder Humor entwickeln
Gefühle, Hoffnungen und Rechte für Roboter und KI: Worauf müssen wir vorbereitet sein?
Brains vs. Robots: Der Aufstieg der Roboter ist nicht aufzuhalten
Warum Gefahr aufregend ist – allerdings nur für manche Leute
Wie kooperatives Verhalten künstliche Intelligenz menschlicher machen könnte
Brainjacking – eine neue Bedrohung der Cybersicherheit
Asoziales Verhalten – Es ist alles in deinem Kopf
Die Entschlüsselung des Nervensystems: Der nächste medizinische Durchbruch steht bevor
Von Medikamenten zu Hirn-OPs: Die Bewusstseins-Technologien der Zukunft
Wie Hirnimplantate gelähmten Menschen helfen können
Könnten wir ein Gehirn hochladen – und sollten wir es überhaupt versuchen?
Objekte mit Gedanken kontrollieren – bald kein SciFi mehr?
Warum uns das Internet nicht klüger macht
Cybathlon: Was Bionik für Millionen von Menschen bedeuten könnte
Sind Selfies die neuen Sicherheitspasswörter?
Mit den eigenen Gedanken Maschinen steuern
Über den Antrieb der Künstlichen Intelligenz von Google und Facebook
5 Lesetipps für den 21. Januar
In unseren Lesetipps geht es heute um Jack Dorsey, den Medienwandel, das Ende des Kapitalismus, Technologie und Mensch, sowie Freunde auf Social Media. Ergänzungen erwünscht. JACK DORSEY Mashable: Twitter CEO Jack Dorsey is no longer a billionaire as of today: Persönlich habe ich keine große Meinung von Jack Dorsey als Geschäftsführer[…]
Warum man nie ein Gehirn in die Cloud hochladen kann
Was mit uns passiert, wenn wir betrunken sind
Wie Witze helfen, die Bedeutung in Sprachen zu entschlüsseln
Das Internet verschlingt unser Gedächtnis
Internetnutzung und das Gehirn: Digitaler Alarm
Was macht das Internet mit unserem Kopf? Zumindest nicht das, was viele glauben. Im Neuro-Psycho-Zeitalter sind wir scheinbar umgeben von pathologischen Phänomenen. Wer sich durch unbedachte Einkäufe verschuldet, leidet unter Kaufsucht. Wer nicht an Verhütung denkt, unterliegt der Sexsucht. Wer an Gesprächen nicht teilnimmt, krankt an sozialen Phobien. Ständige Grübeleien über[…]
Allzweckwaffe Hirnforschung: Monokausale Kleckskunde
Wir Netz-Zombies – Emanzipation des Menschen von den Maschinen
Das Leben im Internet ist eine seltsame Sache: Auf-dem-Bildschirm-Starren, digitale „Kontakte“, Kommunikationsfragmenten und eine durch Links verbundene unendliche Abfolge von Dokumenten. Anders als Fernsehen erfordert Online-Sein Aktivität: permanente Entscheidungen und sogar soziale Interaktionen. Doch nach der Arbeit vor dem Rechner kann sich das eigene Gehirn so weich anfühlen, als hätte[…]
Handys wirken aufs Gehirn
In der Nähe der Antenne eines Mobiltelefons kann man nach einem einstündigen Gespräch ein Zunahme der physiologischen Tätigkeit um 7 Prozent nachweisen, haben die amerikanischen Wissenschaftler um Dr. Nora Volkow jetzt in einer Studie publiziert. Wie immer bei den bildgebenden Verfahren in den Neurowissenschaften kann man außer einem erhöhten Stoffwechsel[…]
Was soll nur aus unseren Experten werden?
Gestern gab es in der FAZ einen Text „Was soll nur aus unseren Gehirnen werden?“, der die Schirrmachersche These vom schädlichen Buchdruck, Radio, Fernsehen, Walkman, Internet bestätigen wollte. Ein Neurobiologe der TU Braunschweig namens Martin Korte sollte es richten. Wir erinnern uns: War die Leitwissenschaft in den Siebzigern die Physik,[…]

![Kopf 1 (adapted) (image by geralt [CC0] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/08/Kopf-1-adapted-image-by-geralt-CC0-via-pixabay-500x350.jpg)
![Child (adapted) (image by Bellezza87 [CC0] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/08/Child-adapted-image-by-Bellezza87-CC0-via-pixabay-500x350.jpg)
![Menschenmenge (adapted) (Image by mwewering [CC0 Public Domain] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/03/Menschenmenge-adapted-Image-by-mwewering-CC0-Public-Domain-via-pixabay-500x350.jpg)
![Arzt (adapted) (Image by tmeier1964 [CC0 Public Domain] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/03/Arzt-adapted-Image-by-tmeier1964-CC0-Public-Domain-via-pixabay-500x350.jpg)
![Fallschirmspringen (image by skeeze [CC0] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/09/Fallschirmspringen-image-by-skeeze-CC0-via-Pixabay-500x350.jpg)
![binary (Image by geralt [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/09/binary-Image-by-geralt-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)
![binary (image by geralt [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/08/binary-image-by-geralt-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.png)
![Punch (adapted) (Image by Edgar Languren [CC0 Public Domain] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/08/Punch-adapted-Image-by-Edgar-Languren-CC0-Public-Domain-via-flickr-500x350.png)
![Image by geralt [CC0] via pixabay](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/07/Image-by-geralt-CC0-via-pixabay-500x350.jpg)
![Thinking (adapted) (Image by Floyd-out [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/08/Thinking-adapted-Image-by-Floyd-out-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)
![chip (adapted) (Image by Sebastian [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/07/chip-adapted-Image-by-Sebastian-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.png)
![Nervenbahnen (image by geralt [CC0] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/07/image-by-geralt-CC0-via-Pixabay-500x350.jpg)
![13365 you're like a rubik's cube (adapted) (Image by Jin [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/05/13365-youre-like-a-rubiks-cube-adapted-Image-by-Jin-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Volunteer Duty Psychology Testing (adapted) (Image by Tim Sheerman-Chase [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/04/Volunteer-Duty-Psychology-Testing-adapted-Image-by-Tim-Sheerman-Chase-CC-BY-2.0-via-flickr--500x350.jpg)

![Selfie (image by JudaM [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/03/Selfie-image-by-JudaM-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)
![Gehirn (image by geralt [CC0 Public Domain] via pixabay)1-1](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/02/Gehirn-image-by-geralt-CC0-Public-Domain-via-pixabay1-1-500x350.jpg)
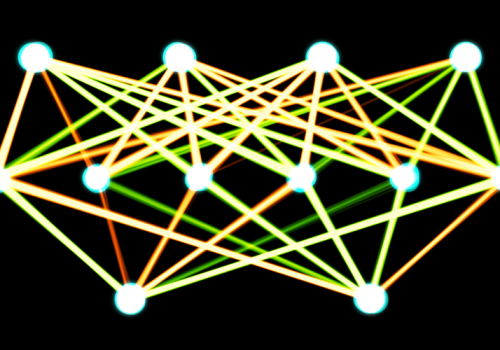
![Exercise Plays Vital Role Maintaining Brain Health (adapted) (Image by A Health Blog [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/01/Exercise-Plays-Vital-Role-Maintaining-Brain-Health-adapted-Image-by-A-Health-Blog-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)

![india laughing (adapted) (Image by anthony kelly [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/12/india-laughing-adapted-Image-by-anthony-kelly-CC-BY-2.0-via-flickr--500x350.jpg)
![Loading... (adapted) (Image by Toms Baugis [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/09/Loading...-adapted-Image-by-Toms-Baugis-CC-BY-2.0-via-Flickr-500x350.jpg)