Gaming statt Hierarchien: Wie Computerspiele das politische System verändern könnten. Nach dem postideologischen Kater der Systemkrise namens Finanzkapitalismus und dem Einsturz des Utopieglaubens bleibt nach Auffassung von Frank Rieger und Fefe nur noch Zynismus und Gamification übrig. Das äußerten sie in einem gut zweitstündigen Gespräch mit dem „FAZ“-Herausgeber Frank Schirrmacher. Abzuhören in ihrer Alternativlos-Podcast-Reihe. Digitale Artefakte werden benutzt, um unsere Soziotope zu gestalten, wenn es etwa um Reputation oder Wissensmanagement geht. „Dabei müssen wir darauf achten, nicht mehr die Rolle eines Game Masters hinzunehmen wie bei Google, der die Regeln bestimmt. Wir müssen verstehen, wie diese Regeln funktionieren“, so Rieger. Und ich würde ergänzen, wie man sie brechen kann. Als besonders fragwürdig werden in dem Podcast Regeln gewertet, die von Algorithmen bestimmt werden wie beim Google-Spiel „Ingress“, das zumindest von Frank Rieger bis zum finalen Level acht durchgespielt wurde. Indoktrination über Software-Versionen Es heißt nur: „Hier hast du das Programm, viel Spaß dabei.“ „Regeländerungen kommen ausschließlich über Software-Updates und plötzlich funktioniert deine Welt anders“, stellt Rieger fest. Er wertet das als Vorboten für soziale Interaktion und Politikgestaltung. Wenn von der Gamification der realen Welt gesprochen werde, könnte man von der „fucking“ Softwareversion abhängig werden. Auf der Strecke bleiben Möglichkeiten der Selbstorganisation, die es allerdings im klassischen Industriekapitalismus nie gab, wie Wolf Lotter sehr eindrucksvoll auf der re:publica skizzierte. In dem kulturpessimistischen Diskurs der Dreier-Runde darf natürlich auch der altväterliche Einwurf über „die“ Jugend und über „die“ Kinder nicht fehlen, die mit Computerspielen aufgewachsen seien, die ihnen vorschreiben, was sie tun dürfen und was nicht. Gamification mache die Masse träge und würde sie indoktrinieren, so der Vorwurf, der auf der Manfred-Spitzer-Skala mit Sicherheit die volle Punktzahl erhält. Gaming als Kulturfaktor Gamification bewirkt allerdings genau das Gegenteil. Das anfängliche Verschweigen der Spielregeln in den meisten Computer- und Videospielen und überraschende Regeländerungen über Software-Updates sind Teil des Spiels. Als Gamer bekommt man Anreize für die Aufnahme von Informationen, um das Spiel zu verstehen und zu erkunden. Man könnte es auch als fortdauernde Versuch-und-Irrtum-Schleife bezeichnen, um sich als aufmerksamer Beobachter zu profilieren. Jedes gute Spiel fordert uns heraus, unnötige Hindernisse freiwillig zu überwinden. Und das mit großer Energie und Anstrengung – ohne Zwang, Anpassung, Unterdrückung oder Macht. In bildungsbürgerlichen Diskursen wird gerne der Gegensatz von Spiel und Ernst kultiviert. Viele Jahre wurde das Ende der Spaßgesellschaft proklamiert und vor dem Niedergang der Hochkultur gewarnt. Dabei ist die Gaming-Szene, sowohl Entwickler als auch Spieler, längst Teil der Alltagskultur – auch wenn das von den Gaming-macht-süchtig-und-deformiert-das-Hirn-Spitzers dieser Welt mit hysterischen Gesängen bekämpft wird. Gegensatz von Spielen ist Depression Diese Abgrenzung ist albern und falsch, meint Soziopod-Blogger Patrick Breitenbach: „Spielen ist immer Arbeit und das in jeder Form – körperlich und geistig. Es geht um Fleiß, um Teamwork, um strategische Denkarbeit, entdeckerische Arbeit und kreative Arbeit.“ Das Gegenteil von Spielen sei eher Depression. Um sich aus der Ohnmacht und dem Gefühl der Machtlosigkeit gegenüber Politik und Wirtschaft zu befreien, bietet die Gamification das nötige Rüstzeug. Was zeichnet analoge und digitale Spiele aus? „Freiwilligkeit, die sich von den Zwängen der Arbeitswelt und den nicht vorhandenen politischen Beteiligungsmöglichkeiten deutlich unterscheidet. Spielen ist nicht sinnlos. Unsere angeblich ernsthafte Realität ist es“, so Breitenbach. Warum das „wahre“ Leben enttäuscht In der von triefendem Kulturpessimismus geprägten Debatte der liebwertesten Spitzer-Gichtlinge über Computerspiele sollte man sich eher die Frage stellen, warum Spiele mittlerweile die ergiebigste Quelle für positive Beschäftigungen sind und das „wahre“ Leben so wenig zu bieten hat. Warum kommen Computerspieler sehr schnell in den von dem Psychologen Mihály Csíkszentmihályi erforschten Flow-Zustand? Flow bezeichnet das völlige Aufgehen des Handelnden in seiner Aktivität. Schulen, Büros, Fabriken und das Alltagsleben sind derzeitig unfähig, uns mit Flow zu versorgen. Spiele bringen uns bei, frei wählbare, anspruchsvolle Formen der Arbeit zu schaffen, die uns stets das Beste abverlangen: „Wir könnten akute Probleme wie Depression, Hilflosigkeit, soziale Entfremdung und das Gefühl von Unzulänglichkeit wirksam bekämpfen, wenn wir spielmechanisch geprägte Arbeit in den Alltag einbänden“, schreibt Jane McGonigal in ihrem Buch „Reality Is Broken. Why Games Make Us Better and How They Can Change Change The World“. Level statt Zensuren Statt Zensuren in Schulen und Universitäten zu vergeben, könnten wir Spiel-Levels vorgeben. Es geht um Missionen und nicht um Klausuren, es geht um Anreize und nicht um Bestrafung. Positiver Stress, der beim Erreichen von Zielen in Computerspielen zur Normalität gehört, wirkt sich auch auf den Lernerfolg aus. So wird am Quest to Learn College in New York City mit Geheimmissionen, Bosslevels, Erfahrungsaustausch, Spezialagenten, Punkten und Stufen operiert und auf klassische Noten verzichtet: „Eine bahnbrechende Fusion von spielerischem Handeln und öffentlichem Schulsystem“, so McGonigal. Intellektuelle Fähigkeiten verwandeln sich in Superkräfte und epische Herausforderungen können nur mit einer Lernkultur gemeistert werden, die Fehler als Antriebsfeder werten und nicht als Schwäche. Die positive Utopie des Spiels Nicht das Spiel und der Homo Ludens sind bedrohlich, sagt Patrick Breitenbach, sondern unsere kaputte, graue und langweilige Realität. Deshalb sollte stärker über den Transfer der Gaming-Kultur in den Alltag nachgedacht werden. Wie kann man das Phänomen der Beteiligung, der Begeisterung und des Engagements auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft übertragen? Das ist eine positive Utopie, so Breitenbach: „Beim Spielen geht es auch um Macht. Aber in einer völlig anderen Ausrichtung. Nicht Unterdrückung, Unterordnung, Gehorsam und Hierarchien, sondern Gestaltungsmacht, Gestaltungsfreiheit, Selbstorganisation und Kooperation.“ Und wenn die Spielregeln langweilen und Software-Updates als reine Geldschneiderei von der Game-Community entlarvt werden, stimmen wir radikal mit den Füßen ab und gehen zum nächsten Spiel, wie es mein Sohn Constantin in unserem Interviewformat „Sohn fragt Sohn“ zum Ausdruck brachte. Auf der Gamescom in Köln setzen wir diesen Diskurs mit Hangout-Liveberichten fort. Mehr zu Themen des Netzes und dem digitalen Wandel gibt es auch vom European-Kolumnisten Lars Mensel in seinem aktuellen Artikel „Der Getriebene: Facebook Home und die Zukunft des Netzwerkes„.
Dieser Beitrag ist zuerst erschienen auf The European.
Image (adapted) „4519439352“ by vancouverfilmschool (CC BY 2.0)
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: computerspiele, digitalisierung, gamification, politik

![4519439352 (adapted) (Image by vancouverfilmschool [CC BY 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/4519439352-adapted-Image-by-vancouverfilmschool-CC-BY-2.0-via-flickr-555x320.jpg)

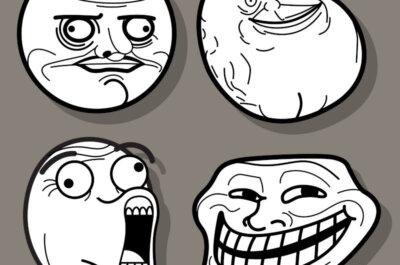

1 comment
Spiel aktiviert unmittelbar das Belohungssystem im Gehirn und ist somit viel näher an der ursprünglichen Selbststeuerung als „moderne“ Motivationstechniken wie jährliche Feedback-Runden oder Karriereplanung.
Die Verhaltenstherapie zeigt, dass Verhalten nur bei sofortiger Belohnung sich ändert und zur Befriedigung führt.
Daher gilt: Arbeit und Mühe brauchen eine schnelle Belohung. Mit geeigneter Software können auch abstrakte Leistungen sichtbar gemacht und die entsprechende Rückkopplung geliefert werden.