All posts under debatte
Verschärfen Soziale Medien die politische Debatte in Großbritannien?
Die Bibliothek wird als Ort der Arbeit neu gedacht
Wir sind viele – Dekoder will Russlands Diskurse sichtbar machen
Deutsche Stiftungen und die Digitalisierung: Chance vertan?
“Future of Data”: Daten-Debatten jenseits von Vorurteilen
Statt Debatten über die “Datensammelwut” von Unternehmen zu führen, sollte das Sammeln und die Verwendung von Daten ganzheitlicher gesehen werden. Das Szenario Building ist zu einem beliebten Werkzeug geworden und ersetzt das bekannte Bonmot “Wenn du mal nicht weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis”. So ist auf Ebene der politischen[…]
This is not a Rückblick
Die Fiktion der Urheberschaft und ihre gesellschaftliche Gebrechlichkeit
5 Lesetipps für den 28. August
In unseren Lesetipps geht es heute um die Kommunikation von Ai Weiwei, Debatten über Netzkonzerne, unabhängigeren Datenschutz, Journalismus und Selbstzensur in sozialen Netzwerken. Ergänzungen erwünscht. NETZPOLITIK Spiegel Online: Sascha Lobo über die Dämonisierung der Netzkonzerne: Die SPON-Kolumne von Sascha Lobo als Lesetipp zu verlinken ist irgendwie zu sehr stating the obvious,[…]
(De)formiert die Digitalisierung unser Leben?
Wo liegt die Schmerzgrenze des öffentlich-rechtlichen Rundfunks?
Journalismus und Fehlerkultur: Die Angst vor dem Scheitern
Journalismus – Die Vierte Gewalt im Tumult
Eine innovative Gesellschaft muss die Digitalisierung nutzen
Fünf Erwartungen an die Debatte über Journalismus
Journalismus: Lasst euch nicht ausbremsen!
Wenn es um Innovationen geht, gibt es immer solche Menschen, die sie vorantreiben oder zumindest mitziehen und solche, die zurückbleiben. Mitschleifen sinnlos. Wir kennen das alle: einige Engagierte schieben eine Debatte an, entwickeln Ideen und versuchen, sie unter das Volk zu bringen. Dieses wiederum kann damit nicht wirklich etwas anfangen[…]
NSA-Spionage und die Gefahr aus dem Osten
Medienwandel: Reden wir über Buzzfeed!
Nach der Wahl: die Netzpolitik muss 2.0 werden
5 Lesetipps für den 20. September
In unseren Lesetipps geht es um die Zukunft von PR, eine Artikelreihe zur digitalen Gesellschaft, Videochat-Alternativen, Netzneutralität und Meilensteine des Internets. Ergänzungen erwünscht. PUBLIC RELATIONS Pressesprecher: Hat PR eine Zukunft?: Während viele Köpfe aufgeregt über die Geschäftsmodelle eines modernen Journalismus debattieren, steht auch die PR-Branche vor einem Paradigmen-Wechsel. Thomas Mickeleit, Director[…]
Experimentierfreude im digitalen Journalismus
Komm mit mir ins Neuland
Katharina Große, Tinka genannt, schreibt in ihrer Kolumne über den digitalen Wandel in unserer Gesellschaft. Diesmal sinniert sie über die Neuland-Metapher von Bundeskanzlerin Merkel nach. #Neuland ist inzwischen fast ein alter Hut, aber ich möchte ihn mir noch einmal aufsetzen. Ob das jetzt eine gut oder schlecht gewählte Aussage war[…]
Parallelen zwischen Hip Hop und der Mediendebatte #tag2020
Facebook und die Klarnamenpflicht – a never ending story
Wer anonym auftreten will im Netz, dem wird es zuweilen schwer gemacht. Ausgrenzung ist nicht selten das Ergebnis. Dass man auf Facebook nur mit seinem Klarnamen auftreten darf, bekommt man direkt beim Registrierungsprozess mitgeteilt. Dass viele Nutzer dies dennoch nicht tun, ist dem sozialen Netzwerk immer mehr ein Dorn im[…]
Internet Manifest – Nachlese
Vor gut vier Wochen veröffentlichten einige im Web bekannte Journalisten und ihre Bekannten das Internet Manifest. Sie wandten sich damit vordergründig gegen Zeitungsverleger, die eine Überarbeitung der Gesetze verlangen, damit sie ihr bisheriges Geschäftsmodell bewahren können. Das bestand bis dato darin, dass man Reichweiten (Leser), die durch ein Übergewicht an[…]
Möchtegern-Debatte 2.0 auf N24
Heute Abend wird um 23:30 Uhr auf N24 die Sendung Debatte 2.0 ausgestrahlt. „2.0“ deswegen, weil die Zuschauer dem Gast, Bayerns Ministerpräsidenten Günther Beckstein, im Vorfeld Fragen per Videoclip oder MMS stellen konnten. N24 definiert das als „interaktiv“, was es de facto aber eher nicht ist. Denn interaktiv wäre es,[…]


![Westminster (adapted) (Image by Hernán Piñera [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/06/Westminster-adapted-Image-by-Hernán-Piñera-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
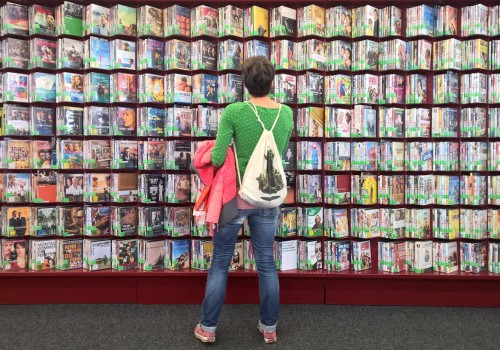

![The Big Debate (Image by The Big Debate [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/09/The-Big-Debate-Image-by-The-Big-Debate-CC-BY-SA-3.0-via-Wikimedia-Commons-500x350.jpg)
![I Cant See You... (adapted) (Image by Peter [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/05/I-Cant-See-You...-adapted-Image-by-Peter-CC-BY-SA-2.0-via-Flickr-500x350.jpg)
![CTRL (Bild by Bruno [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/03/CTRL-Bild-by-Bruno-CC-BY-SA-2.0-via-Wikimedia-Commons-500x350.jpg)


![Please try again (adapted) (Image by Samantha Marx [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Please-try-again-adapted-Image-by-Samantha-Marx-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)
![Turmoil (adapted) (Image by marcusrg [CC BY 2.0], via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Turmoil-adapted-Image-by-marcusrg-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Working offline, sort of (adapted) (Image by dhaun [CC BY 2.0], via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Working-offline-sort-of-adapted-Image-by-dhaun-CC-BY-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![Lliga de debat UB - 2011 (adapted) (Image by Joan Simon [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/12/Lliga-de-debat-UB-2011-adapted-Image-by-Joan-Simon-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.jpg)

![TechCrunch Disrupt NY 2013 - Day 1 (adapted) (Image TechCrunch [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/TechCrunch-Disrupt-NY-2013-Day-1-adapted-Image-TechCrunch-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)
![People (adapted) (Image by ThisParticularGreg [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/People-adapted-Image-by-ThisParticularGreg-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.png)

![Don't Blame Yourself...Blame Hip-Hop (adapted) (Image by Angie Linder [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Dont-Blame-Yourself...Blame-Hip-Hop-adapted-Image-by-Angie-Linder-CC-BY-SA-20-via-Flickr-500x350.png)