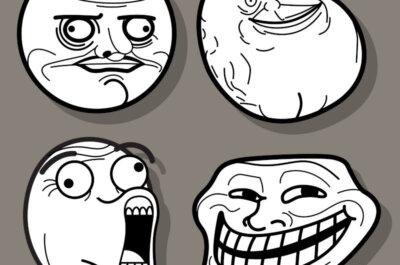Auch Visionäre kommen in die Jahre – niemand hat das in den vergangenen Monaten eindrücklicher demonstriert als Jaron Lanier. In den 80ern gehörte er zu den Cool Kids der Netzszene, schraubte an Ideen für „virtuelle Ideen“, begann, an diversen US-Eliteunis Computerwissenschaften zu unterrichten. Gut zwanzig Jahre später hat er sich vor allem aufs Ablehnen verlegt. Kollektive Projekte im Internet? Digitaler Maoismus, sagt der heute 50-jährige Dreadlockträger. Projekte wie Wikipedia oder Linux sind in seinen Augen antidemokratisch, weil sie der Idee anhängen, dass das Kollektiv über eine allwissende Weisheit verfüge, die man zentral bündeln und lenken müsse. An die Stelle eines kreativen Individuums würde ein digitaler Mob treten – doch historisch, so meint er, seien es stets Individuen gewesen, die den Fortschritt befeuert hätten.
Nicht viel besser weg kommt die Free Culture-Bewegung. Ein Holzweg, meint Lanier – Kreative würden ausgebeutet, kriechen finanziell so übel auf dem Zahnfleisch, dass ihnen weder Kraft noch Zeit bliebe, substantiell Neues zu erfinden. Stattdessen lebe die Mash-Up-Kultur hoch, die vergangene Musikinnovationen zu einem Mainstream-Einheitsbrei vermenge und in Endlosschlaufen weitervermarktete.
Schon seit 2006 bastelt Lanier an dieser Pauschalkritik, in diesem Jahr hat er sie gebündelt in seinem Buch „You are not a gadget“ zusammengetragen. Für Statements an die deutsche Presse, so sein Assistent, steht der Autor derzeit nicht zur Verfügung – im Herbst wieder, wenn Lanier sein Buch in der deutschen Übersetzung promote. Nein, auch Statements auf zwei Fragen per Mail seien nicht drin. Darum also hier eine Diskussion seiner Thesen auf Basis anderer Interviews, alter Artikel – und mit kritischen Gegenstimmen aus deutschen und US-Netzkreisen.
Es wäre ziemlich einfach, Lanier einfach als verbitterten Ergrauten abzutun, den die Entwicklung des kollaborativen Internets einfach links überholt hat. Denn tatsächlich ist das Netz nicht mehr die Garagen-Bastel-Veranstaltung, in der Lanier digital sozialisiert wurde. Heute gibt es Einzelne, die gute Ideen zur rechten Zeit hatten – und damit heute einen Batzen Geld machen, von Zuckerberg bis zu Brin und Page. Die deutsche Bachmann-Preisträgerin Kathrin Passig erfand im letzten Jahr einen hübschen Begriff für jene, die noch immer an ihren vor Jahren geprägten digitalen Weltbild festhalten, ohne zu bemerken, dass die Dinge sich seitdem rasant weiterentwickelt haben, sie mir ihren einstmals so visionären Ideen heute ziemlich gestrig aussehen: Digitale Glatzenüberkämmer. Im Spiegel habe man selbst den Eindruck, alles sehe aus wie immer – aber alle anderen würden deutlich sehen, dass es eben doch nur drei über den Kahlkopf gelegte Haare seien.
Doch tatsächlich gibt Lanier – zumindest mit seiner Free-Culture-Kritik – einem Reflex Ausdruck verleihen, der verständlich ist: Nach einer frühen Phase des Non-Profit-Optimismus, in der viele Netzkreative aus Idealismus oder im festen Glauben an das Dogma „kein Geld, aber Bekanntheit“ auf eigene Rechnung arbeiteten, scheinen derzeit viele auf den Trip zu kommen, dass ein bisschen Lohn für die eigene geistige Arbeit doch eigentlich auch eine feine Sache sei.
Doch ganz abgesehen davon, ob es infolge dessen angemessen ist, ein neues, netzadäquates Kooperationsmodell pauschal zu bashen (darauf werde ich später noch näher eingehen) macht der Lösungsvorschlag, den Lanier anbietet, doch einen recht verstaubten Eindruck. Er will ein universelles Micropayment-System installieren, über das Künstler entlohnt werden sollen.
„We should effectively keep only one copy of each cultural expression—as with a book or song—and pay the author of that expression a small, affordable amount whenever it’s accessed.“
schreibt Lanier. Eingetrieben nicht von kommerziellen Anbietern wie iTunes natürlich, sondern von einer Art Verwertungsgesellschaft oder gar einer staatlichen Institution.
Eine derartige zentralistische Idee ist im Netz mit seinen Streubewegungen in Blogs, auf Webseiten etc. auf wenig Gegenliebe gestoßen. Slate-Autor Michael Agger schreibt noch relativ milde:
not a bad concept, but a platonic idea that sounds great in theory. I don’t see the government opening an iTunes store anytime soon.
Interessant daran: Eines von Laniers Anliegen ist, Geld den Künstlern zuzuführen statt es bei den großen Unternehmen liegenzulassen. Aber Geld an iTunes, Google und Co vorbeizuschleusen, indem man über eine staatliche oder semi-staatliche Behörde Kulturgüter monetarisiert, hat doch viel mehr von Enteignung, also Sozialismus als die Idee des kollaborativen Arbeitens an Ideen. Denn im Ernst: Natürlich kann man neidisch konstatieren, dass Apple im Musikbereich und Google im Nachrichtensektor mit einer frühen, guten Monetarisierungsidee geschafft haben, Geld zu scheffeln, das den Künstlern oft fehlt, und haben dabei sogar monopolartige Strukturen errichtet. Sie aber über zentralistische oder staatliche Behörden auszuhebeln, ist nicht gerade eine konsistente Idee von jemandem, der in anderer Hinsicht mit dem Kampfbegriff des Maoismus um sich wirft.
An alternativen Ideen für Web-Bezahlsysteme, die die Künstler stärker mit einbeziehen, denken derzeit viele herum – ohne bislang den goldenen Löffel gefunden zu haben, der Journalisten, Künstler, Musiker, Zeichner und alle anderen Netzkreativen in Zukunft füttern wird. Nicht überraschend, wie Clay Shirky in einem Aufsatz zur Erosion auf dem US-Printmarkt ausführte. Ähnlich wie nach der Erfindung von Gutenbergs Buchdruck revolutionieren auch digitale Vertriebswege das Pressewesen – und was an ihre Stelle tritt, sei aus heutiger Sicht noch vollkommen offen:
When someone demands to know how we are going to replace newspapers, they are really demanding to be told that we are not living through a revolution. […] They are demanding to be lied to. […] “You’re gonna miss us when we’re gone!” has never been much of a business model. So who covers all that news if some significant fraction of the currently employed newspaper people lose their jobs? I don’t know. Nobody knows. We’re collectively living through 1500, when it’s easier to see what’s broken than what will replace it. […] Any experiment, though, designed to provide new models for journalism is going to be an improvement over hiding from the real, especially in a year when, for many papers, the unthinkable future is already in the past. For the next few decades, journalism will be made up of overlapping special cases. Many of these models will rely on amateurs as researchers and writers.[…] Many of these models will fail. No one experiment is going to replace what we are now losing with the demise of news on paper, but over time, the collection of new experiments that do work might give us the journalism we need.
Ein US-optimistischer Ansatz: Vieles ausprobieren, viel scheitern – um am Ende vielleicht eine Lösung zu finden. Das stiftungsgeförderte ProPublica, jüngst mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet, ist einer der Testballons, die Shirky hier meinen könnte, die crowdfunding-Seite spot.us oder die Huffington Post.
Auch auf dem Musikmarkt, um den es dem Unter-anderem-Musiker Lanier ja auch geht, ist es im Grunde ähnlich. Derzeit in einer Anarchiephase, wird sich nach dem Abhängen der großen Plattenmajors erst langsam herausstellen, wie das Ernähren einer breiten Musikermasse im digitalen Zeitalter funktionieren wird. Erfolgversprechend scheinen derzeit vor allem Systeme zu sein, die auf Spendenbasis funktionieren – etwa, indem Fans die Plattenproduktion einer Band via Crowdfunding vorfinanzieren, indem an Projekte und Musiker, die man gut findet, gespendet wird. Dass das funktionieren kann, zeigen die ewig zitierten Bands in diesem Zusammenhang: Nine Inch Nails, die Einstürzenden Neubauten, Radiohead oder auch – um mal ein unbekannteres Beispiel zu nehmen, die Kölner Schrammelindierocker von Angelika Express.
Nicht vernachlässigen sollte man aber zwei Aspekte: Lanier kritisiert, dass mittelgroße Bands sich heutzutage die Finger wund spielen müssen, um überhaupt überleben zu können. Das mag richtig sein. Diverse Studien belegen aber, dass „das Internet“ daran nur bedingt Schuld trägt: Wer kostenlos Musik im Netz herunterlud, gab auch überdurchschnittlich viel Geld für Konzerte, Merchandising und ja, auch Kaufmusik aus. Außerdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass mit dem Wegfall des Veröffentlichungs-Nadelöhrs Plattenindustrie die Zahl der Anbieter von Musik (im Sinne von Bands) deutlich in die Höhe geschossen ist – ohne dass die Bereitschaft der Hörer, immer mehr Geld für Musik auszugeben, im gleichen Maße gestiegen ist. Außerdem – um mal ein nicht mehr taufrisches Argument auszupacken – ist in allen künstlerischen Bereichen die Frage, wie lange und ausgiebig ein Künstler oder seine Erben das Recht haben soll, an seinem Werk zu verdienen. Natürlich wäre es ein Paradigmenwechsel, Autoren und Künstler wie einen Bäcker zu entlohnen – er verkauft sein Werk einmal, danach ist es frei zugänglich (zugegeben, der Vergleich hinkt, weil ein Brötchen sich nicht beliebig reproduzieren lässt). Dass das durchaus funktionieren kann, demonstrieren zahllose Free Culture-Anhänger wie der Berliner Designer Ronan Kadushin eindringlich, der die Baupläne seiner Möbel nach einmaligem Verkauf frei zur Verfügung stellt.
Klar ist: mit solchen Modellen wird man nicht reich werden. Natürlich lohnt es sich, über neue Methoden nachzudenken. Aber aus Ärger über finanzielle Unzulänglichkeiten pauschal alle kollektiven Netzprojekte als Mumpitz zu geisseln, so wie Lanier es tut, ist mit Sicherheit die am wenigsten konstruktive Variante, auf die aktuellen Netzbewegungen zu reagieren.
Geistreiche und auch prominente Entgegnungen auf Laniers Maoismus-Vorwurf finden sich im übrigen auf edge.org (bereits seit 2006). Geschrieben von etwas frischeren Netzavantgardisten als Lanier – Leuten wie Clay Shirky, Howard Rheingold und natürlich auch Jimmy Wales. So klug, dass ich sie nicht kopieren, sondern einfach nur darauf verlinken möchte. Manchmal loht es sich eben doch, eine Diskussion anzuzetteln und gemeinsam an einem Problem herumzudenken. Besonders, wenn nicht nur ein schlaues Individuum seinen Input gibt, sondern viele davon konstruktiv an etwas herumdenken. Oder warum eigentlich manchmal? Eigentlich so gut wie immer.
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: Digitaler Maoismus, Free Culture, Lanier, Netzkultur, Shirky