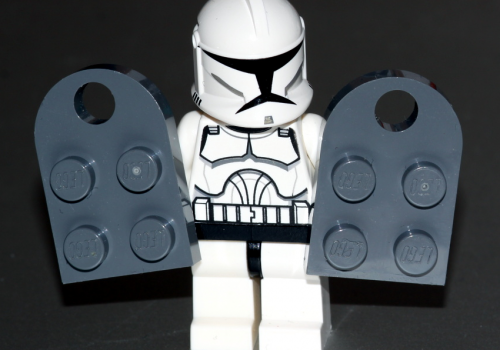All posts under Trojaner
Wusste die NSA über „Meltdown“ und „Spectre“ Bescheid?
Bundesinnenminister will Hintertüren in Smart-Devices
Kann man Trojaner impfen, um Cyber-Attacken zu verhindern?
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
WhatsApp-Überwachung: Neue Forderungen verfehlen das Ziel
WannaCry: Die Exploit-Policy der Behörden ist zum Heulen
Welchen Virenscanner Mac-Nutzer wann brauchen
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
Nematode: Auch „gute” Würmer sind gefährlich
FollowUs – Die Netzpiloten-Tipps aus Blogs & Mags
Ransomware-Boom zeigt Notwendigkeit von Backups auf
Die Mainzer Erklärung: Beispiel für die Ausweitung von Überwachung
Mehr Sicherheit für kritische Infrastrukturen
5 Lesetipps für den 20. Juli
In unseren Lesetipps geht es heute um Snapchat-Konkurrent Beme, Trojaner-Baukästen, einen Sensor für Autofokus, das Fairphone 2 und einen API-Browser. Ergänzungen erwünscht. BEME t3n: Snapchat-Konkurrent Beme: Bei diesem Social Network zeigst du dein wahres Ich: Mit der App Beme, hat der Social-Media Experte Neistat eine App gestartet, bei der die[…]
Spyware: Das Geschäftsmodell der Überwachungsindustrie
Die 10 Gebote, des mündigen Anwenders
Reingefallen: Kind legt Rechner lahm
Katrin Viertel von medienlotse.com beantwortet Fragen rund ums Thema Erziehung und digitale Medien. Heute geht es um Spam per Kettenbrief und andere üble Scherze. Meine Tochter (11) erhielt eine Mail, in der sie von „Sicherheitsexperten“ aufgefordert wurde, eine bestimmte Datei von unserem Rechner zu entfernen, da sonst ein überall kursierendes[…]
Behörden-Trojaner schlecht programmiert?
Die neue Frontlinie der Behörden, die den öffentlich bezahlten Trojaner in diversen Varianten einsetzen, kommt nun vom Hersteller selbst. Das Tool sei von 2007. Offenbar haben weder die Sicherheitspolitiker noch deren nachgeordnete Exekutivbehörden das Urteil des obersten Gerichts gelesen. Denn dort ist ganz klar gesagt worden, dass es aus Sicht[…]


![Radar, Funktechnik, Signale (adapted) (Image by stux [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2018/01/Radar-Funktechnik-Signale-adapted-Image-by-stux-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)
![Time traveler (adapted) (Image by Alessio Lin [CC0 Public Domain] via Unsplash)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/12/Time-traveler-adapted-Image-by-Alessio-Lin-CC0-Public-Domain-via-Unsplash-500x350.jpg)
![Neourban, Laptop, Hardware (adapted) (Image by markusspiske [CC0 Public Domain] via pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/10/Neourban-Laptop-Hardware-adapted-Image-by-markusspiske-CC0-Public-Domain-via-pixabay-500x350.jpg)

![spy-whatsapp-messages (adapted) (Image by Sam Azgor [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/02/spy-whatsapp-messages-adapted-Image-by-Sam-Azgor-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)

![robot (adapted) (Image by DirtyOpi [CC0 Public Domain] via Pixabay)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/03/robot-adapted-Image-by-DirtyOpi-CC0-Public-Domain-via-Pixabay-500x350.jpg)
![computer-sicherheit-image-by-TheDigitalWay-via-Pixabay-[CC0 Public Domain]](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/11/computer-sicherheit-500x350.jpg)
![Schloss (image by stevebp [CC0 Public Domain] via Pixabay)new](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/03/Schloss-image-by-stevebp-CC0-Public-Domain-via-Pixabaynew-500x350.jpg)
![Video surveillance out of control (adapted) (Image by Alexandre Dulaunoy [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2016/01/Video-surveillance-out-of-control-adapted-Image-by-Alexandre-Dulaunoy-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.png)
![Cyber attacks (adapted) (Image by Christiaan Colen [CC BY-SA 2.0] via flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/12/Cyber-attacks-adapted-Image-by-Christiaan-Colen-CC-BY-SA-2.0-via-flickr-500x350.jpg)
![WHAT ARE YOU LOOKING AT (adapted) (Image by nolifebeforecoffee [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2015/02/WHAT-ARE-YOU-LOOKING-AT-adapted-Image-by-nolifebeforecoffee-CC-BY-20-via-Flickr-500x350.png)