Es ist zum Verzweifeln: In den Führungsetagen gibt es das Mitmach-Web höchstens als Schlagwort. Statt Innovationen zu nutzen, ergötzen sich deutsche Führungskräfte an Powerpoint-Monologen. „Der Kunde entscheidet darüber, was ein Unternehmen ist.“ Dieses Zitat stammt vom legendären Management-Berater Peter Drucker. Bemerkenswert an diesem Ausspruch: Er ist 60 Jahre alt! „Die Konsumentendemokratie ist also kein so neues Phänomen, wie sie uns heute erscheint. Vielmehr bringen Internet und Social Web lediglich ans Licht, dass echte Kundenorientierung allzu häufig eher Absichtserklärung als gelebte Praxis ist“, sagt Questback-Marketingmanager Ken Kasischke.
Das Machtgefüge würde sich zugunsten der Kunden verschieben. Die Unternehmen hätten das Monopol über ihre Markenbotschaften verloren. Everybody’s a publisher: Man vertraue anderen Kunden mehr als irgendwelchen offiziellen Markenversprechen. Ähnliches verkünden Karl-Heinz Land und Professor Ralf T. Kreutzer in ihrem Buch „Digitaler Darwinismus“. Sie sprechen von der Notwendigkeit der digitalen Transformation, die in Europa und Deutschland nicht so richtig vom Fleck kommt. Aber ist das nun ein technologisches Problem im mangelhaften Umgang mit digitalen Technologien, wo doch jeder Laie in kurzer Zeit mit Social-Web-Werkzeugen umgehen kann – ohne Informatikstudium? Die Kalenderweisheiten der Slipper-Manager Es ist eher ein kulturelles Problem. Die Krawattenfraktion im Management, die sich auf Internet-Tagungen salopp mit Polohemd und Slipper-Schuhen in Szene setzt, kann mit der Wirklichkeit des Mitmach-Webs wenig anfangen. Da labern Führungskräfte und sogenannte Keynote-Speaker auf öligen Kongressen ihre Kalenderweisheiten ins Publikum und ergötzen sich an irgendwelchen Statistiken über die Relevanz von Facebook und Co. Veredelt wird das Gesagte mit bunten Powerpoint-Präsentationen. „Die sind reserviert für bullet points – kurze, knappe Statements (‚Sätze‘). Gut so, denkt sich der abendländisch geschulte Mensch: Da muss der Autor sich auf das Wesentliche beschränken und prägnant formulieren. Tut er aber nicht, sondern produziert generische Sätze, die zu allem passen und nichts sagen“, kritisiert „Zeit“-Herausgeber Josef Joffe. Es fehle alles, was gute Kommunikation ausmacht: So dozierte Telekom-Chef René Obermann vor ein paar Jahren über die neue Markenstrategie seines Konzerns. „One Company. One Service. Wir haben Marketing und Vertrieb gestrafft, die Zahl der Marken reduziert und die neue Markenarchitektur etabliert … Wir haben die bisherige Kommunikation auf den Prüfstand gestellt und uns für eine Vereinfachung unserer Marktansprache entschieden.“ Er hätte es nach Auffassung von Joffe prägnanter sagen können: „Wir verringern Personal und Produkte. Wir wollen verständlich mit den Kunden reden.“ Das ist aber überhaupt nicht die Absicht der Top-Manager. Powerpoint-Monologe Der Publizist Alexander Ross hat aus seinem langjährigen Erfahrungsschatz im Umgang mit Managern, als Moderator bei Fachkonferenzen und Redner eine Typologie des Powerpoint-Schwätzers erstellt: Da gibt es den „Überflieger“, der uns mindestens zehn Folien pro Minute um die Ohren haut, kurze Kommentare zu jeder Folie brubbelt und vor dem schnellen Weiterblättern noch darauf hinweist, dass die Zuhörer die Wortbrocken später im Detail nachlesen können. Häufig anzutreffen ist der „Im-Bild-Steher“. „Wahre Könner verbinden beides zu einer erratisch anmutenden Choreografie. Der ‚Im-Bild-Steher‘ verdeckt gerne die Projektion, während er wieder und wieder auf die Folie schaut“, so Ross. Artverwandt mit diesem Typus ist der schüchterne Hosenscheißer. Er redet zur Folie oder zur Wand, vielleicht auch zu sich selbst – in jedem Fall ist es unmöglich, diesem inneren Monolog zu folgen. Zum Typus des „Befehlers“ gehören nicht nur Top-Führungskräfte, sondern viele, die sich aufgrund ihrer Position wenigstens einen Leibeigenen oder sonstigen Domestiken leisten können. Befehler beschränken sich bei Präsentationen auf das Reden, unterbrochen durch herrische Kommandos an den subalternen Helfer, endlich die nächste Folie an die Wand zu werfen. Für den strebsamen „Vorleser“ ist Ablesen unverzichtbar, da er mit Folien arbeitet, die überquellen und selbst mit Fernglas schwer zu entziffern sind. Fließband-Kommunikation Egal, ob es nun um soziale Netzwerke oder andere Themen geht: Es ist Fließband-Ware von einschlägigen Veranstaltern, die für schlappe 1.000 oder 2.000 Euro pro Teilnehmer über Hochglanz-Broschüren und Newsletter verkauft wird. In hoher Taktung präsentiert man die Propaganda wie Schweinebauch-Reklame in Anzeigenblättern. Eine Kultur des offenen Austauschs und Dialogs sieht anders aus. Die liebwertesten Gichtlinge der Wirtschaft sollten sich mal an der Organisation von Barcamps versuchen, wo die Teilnehmer das Programm selbst bestimmen können. Hier gibt es keine Sprachregelungen, dümmlichen Verkäufersprüche von der Kanzel und versnobten Wichtigtuer-Gespräche beim Verzehr von Blätterteigtaschen mit Thunfisch-Füllung, Lachsmousse, Fleischpastetchen und Scampi-Mango–Spießen. Wer vom Social Web redet, sollte auch sein Handeln danach ausrichten.
Dieser Beitrag ist zuerst erschienen auf The European.
Image (adapted) „TUI – mid-course presentation“ by Tobias Toft (CC BY 2.0)
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: kommunikation, Social Media, Twitter

![TUI - mid-course presentation (adapted) (Image by Tobias Toft [CC BY 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/TUI-mid-course-presentation-adapted-Image-by-Tobias-Toft-CC-BY-20-via-Flickr-1000x500.jpg)
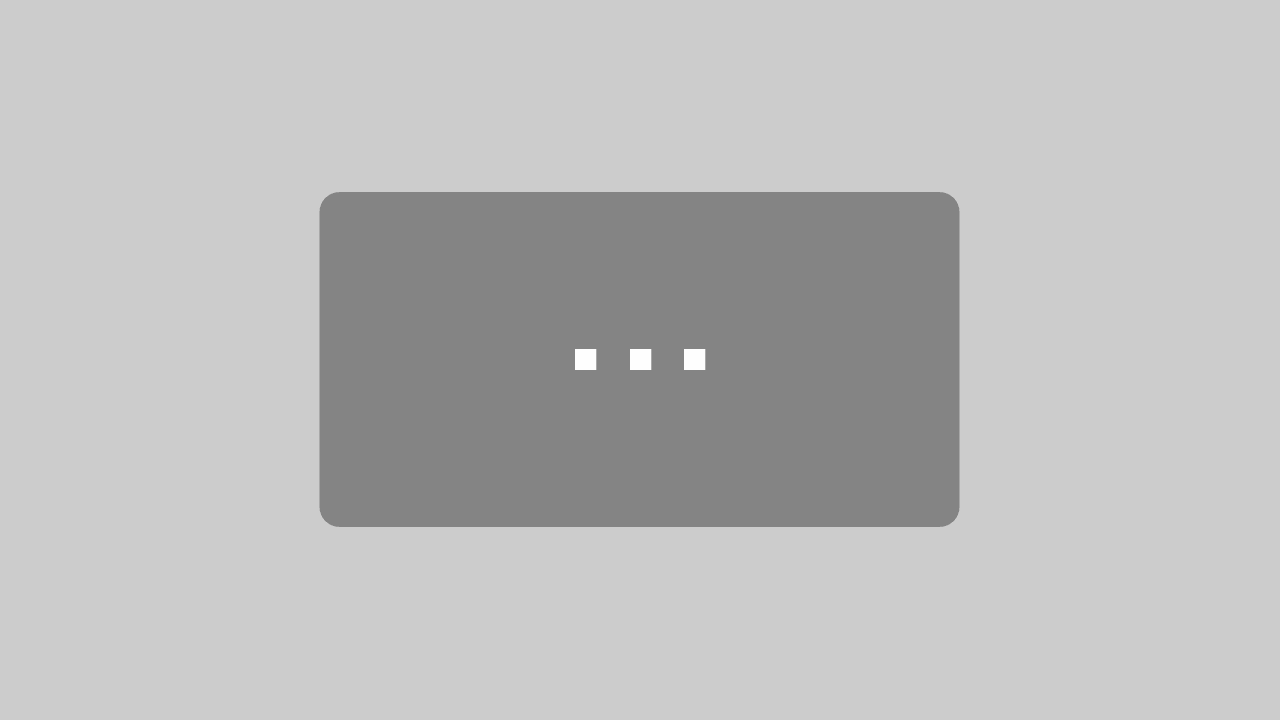



4 comments
Ein wirklich guter Artikel, der den Leuten in den Chefetagen die Augen öffnen könnte.
Social Web ist das Topthema überhaupt. Und kein Mensch. der sich im Web bewegt, sollte dieses Thema auf die leichte Schulter nehmen!
Zwei kritische Punkte gibt es zum Buch anzumerken: Ich schätze es, wenn ich vor der Lektüre eines Kapitels weiss, von wem und aus welcher Perspektive es geschrieben wurde. Das Suchen nach den Autoren am Ende des Kapitels habe ich als mühsam empfunden. Und zum Zweiten: Besonders in der ersten Hälfte des Buches wäre es wertvoll gewesen, all jene Kapitel, die mit den ewig gleichen Einleitungssätzen zum omnipräsenten Facebook starten, zu bereinigen. Das war’s dann aber schon.