Die innere Uhr der politischen Entscheider ist immer noch auf industrielle Produktion gepolt. Kein Wunder, dass sie sich mit der Sharing Economy so schwer tun. „Wirtschaftswoche“-Chefreporter Dieter Schnaas teilt die aufgeladene Debatte über die Deutungshoheit der Share Economy in zwei Lager auf.
Da sei die Graswurzel-Bewegung, ursprünglich ausgehend von Trendforschern, grünen Nachhaltigkeitsfreunden und netzromantisch bewegten Piraten, die im Teilen von Files und Creative Commons das bessere Haben erblicken; die von Zugang, Teilhabe, Mitsprache, Transparenz und Emanzipation schwärmen. Dann gibt es die Deregulierungsapologeten der alten Schule, die sich von Internet-Plattformen wie „Uber“ und „Airbnb“ frischen Innovationswind versprechen. Sie freuen sich über den Angriff auf verkrustete Strukturen sowie bürokratisierte Traditionen und sehnen sich im Namen des Wettbewerbs den Todesstoß für das zünftische Denken und den Verbotsstaat herbei. „Sie feiern die Freiheit des Smartphone-Konsumenten und die Freiheit der Jungunternehmer, die alte Regeln brechen und Geschäftsmodelle zerstören: Schumpeter lebe hoch“, so Schnaas.
Nutzen statt besitzen ist nicht naiv
Die Vorstellung, dass das „Habenwollen“ an Bedeutung verlieren könne, nur weil gestreamte Musik und Filme fast nichts mehr kosten, ist nach seiner Auffassung genauso naiv wie die Vorstellung, dass das Internet ein machtfreier Bezirk sein kann, eine Infrastruktur unter anderen, ähnlich dem Straßen- oder Schienennetz. So ganz falsch ist die Beschreibung der verschiedenen Lager nicht, die sich unversöhnlich gegenüberstehen. So ganz richtig aber auch nicht. Was Schnaas unabhängig von seiner ideologischen Sortierung als naiv abtut, ist volkswirtschaftlich ein zentraler Effekt der Digitalisierung: Die Anwendung und der Nutzen von Produkten werden wichtiger als der Besitz, was die liebwertesten Industrie-Gichtlinge im Land der Forscher, Ingenieure und Baggerfahrer nicht so ganz wahrhaben wollen.
Zugang mit sinkenden Grenzkosten
Das ganze Szenario spielt sich bei drastisch sinkenden Transaktions- und Grenzkosten ab. „Zugang vor Besitz“, wie es der Internet-Vordenker Jeremy Rifkin in seinem zugespitzten Opus „Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft“ beschreibt, breitet sich auf alle Bereiche der Ökonomie aus, fernab von altruistischen oder neoliberalen Sandkasten-Spielchen. Selbst weltweit operierende Unternehmen reagieren auf den Wechsel von Eigentum auf Zugang, indem sie sich stärker als sogenannte „Solution Provider“ positionieren – als Anbieter von Komplett-Lösungen. Was wir erleben und endlich ohne Wehklagen zur Kenntnis nehmen sollten, so Professor Peter Wippermann vom Hamburger Trendbüro, ist die Auflösung von Normen der Industriekultur. Es geht um die Individualisierung des Konsums. Anbieter können sich nicht mehr hinter Industrielobbyisten, Schutzrechten, Meisterbriefen und Innungen verstecken, sondern müssen sich stärker auf die individuellen Präferenzen der Konsumenten ausrichten.
Handelskonzerne werden entmachtet
Globale oder regionale Plattformen ermöglichen es jedem Einzelnen, Kontakte zu Anbietern aufzunehmen, die früher nicht möglich waren, betont Wippermann im ichsagmal.com-Interview.
Über mobile Applikationen bekommt man Auswahlsysteme, um selber mit Knopfdruck Konsumentscheidungen zu treffen, ohne staatliche Vorgaben und Platzhirsch-Gebaren von Dienstleistern und Produzenten. Globale und lokale Plattformen bauen Hierarchien ab, die normalerweise von Händlern und Produzenten gehegt und gepflegt werden. Deshalb geht die Kritik am Plattform-Kapitalismus, der mächtige Meta-Händler hervorbringt, wie es Sascha Lobo in seiner „Spiegel“-Kolumne skizziert, an der Realität vorbei. Wir erleben tatsächlich ein Ende der klassischen Mittelsmänner, die über Preisdiktate ihre Dominanz zelebrierten. Beispielsweise die fünf großen Handelskonzerne in Deutschland, die 80 Prozent des Marktes beherrschen und mit ihrer Einkaufsmacht nach Belieben in den Herbstgesprächen Produzenten knechten.
Uber, eBay, Amazon und lokale Netzwerke sind nach Ansicht des Kölner Wirtschaftshistorikers Klemens Skibicki in erster Linie perfekte Matching-Plattformen, um Anbieter und potenzielle Käufer in Verbindung zu bringen. Bei den globalen Plattformen besteht das erste Mal auch für kleine Manufakturen und Dienstleister die Möglichkeit, weltweit die eigenen Produkte zu vermarkten und direkt mit Kunden in Kontakt zu treten. Mit den Handelskonzernen war dies nicht möglich.
Ökonomische Debatte ohne ökonomisches Wissen
Was wir im Streit um die Share Economy erleben, sei eher eine Vulgarisierung der ökonomischen Debatte, kritisiert Skibicki, Professor für Economics, Marketing und Marktforschung an der Cologne Business School. Man argumentiere mit Kampfformeln, aber nicht mit volkswirtschaftlichen Kenntnissen. Etwa bei Begriffen wie Dumping-Preisen oder Dumping-Löhnen oder der von Sascha Lobo beschriebenen Dumping-Hölle, die uns die Netz-Plattformen bescheren. „Dumping bedeutet, dass ich unterhalb meiner Kosten anbiete, um Konkurrenten zu verdrängen. Das kann man in jedem VWL-Lexikon nachschlagen.“ In Wahrheit gehe es um die Senkung der Transaktionskosten. „Anbieter und Nachfrager können sich so einfach finden wie nie zuvor. Viele Zwischeninstanzen sind nicht mehr nötig“, sagt Skibicki.
Selbst in der Autoindustrie hätten das viele Unternehmen verstanden und investieren ins Car Sharing. Sie sehen sich immer weniger als Automobilhersteller, sondern mehr als Transportunternehmer oder Dienstleister für Mobilität.
Wer nicht clever ist, den fressen Uber und Co.
Viele andere Branchen seien nicht so clever, um sich aus eigenem Antrieb zu reformieren. Genau in diese Lücke würden dann aggressive Neulinge wie Uber und Airbnb stoßen. Statt in weiteren industriepolitisch motivierten Abwehrschlachten die Zeit zu verplempern, sollten wir in Deutschland ordnungspolitische Akzente setzen, um uns von den Anachronismen der untergegangenen Industriewirtschaft zu befreien, wie es der Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser in seinem Standardwerk „Deutsche Wirtschaftsgeschichte. Von 1945 bis zur Gegenwart“ ausdrückt. Wo sind klare Konzepte für einen institutionellen Rahmen zu erkennen, um uns auf die Bedürfnisse der nachindustriellen Ära auszurichten? Weder die wirtschaftlichen Eliten noch die öffentliche Meinung waren und sind sich der Realität bewusst, „dass schon Anfang der sechziger Jahre selbst bei stark rohstofforientierten Produzenten, wie der deutschen Großchemie, bis zu zwei Drittel der Wertschöpfung auf der Fähigkeit zur Anwendung von wissenschaftlich basierten Stoffumwandlungsprozessen beruhte“, schreibt Abelshauser in der erweiterten Auflage seines Opus.
Seit den 90er-Jahren sind mehr als 75 Prozent der Erwerbstätigen und ein ebenso hoher Prozentsatz der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung durch immaterielle und nachindustrielle Produktion entstanden. Die innere Uhr der politischen Entscheider ist immer noch auf die industrielle Produktion gepolt. Man merkt es an der wenig ambitionierten Digitalen Agenda der Bundesregierung, man erkennt es an den lausigen Akzenten, die in der Bildungspolitik gesetzt werden, und man hört es bei den Sonntagsreden der Politiker, wenn es um Firmenansiedlungen geht. Es gibt keine Konzeption für eine vernetzte Ökonomie jenseits der industriellen Massenfertigung aus den Zeiten des Fordismus. Die Aufregung über die Share Economy ist wohl eher der Ausfluss des alten Denkens in industriekapitalistischen Kategorien, wo Anbieter und nicht Kunden Taktgeber der Volkswirtschaft waren.
Dieser Beitrag erschien zuerst auf The European.
Image (adapted) „Kran“ by Bastian Greshake (CC BY-SA 2.0)
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: Industrie, Industriewirtschaft, politik, Share Economy

![Kran (adapted) (Image by Bastian Greshake [CC BY-SA 2.0] via Flickr)](https://www.netzpiloten.de/wp-content/uploads/2017/01/Kran-adapted-Image-by-Bastian-Greshake-CC-BY-SA-20-via-Flickr-555x600.jpg)
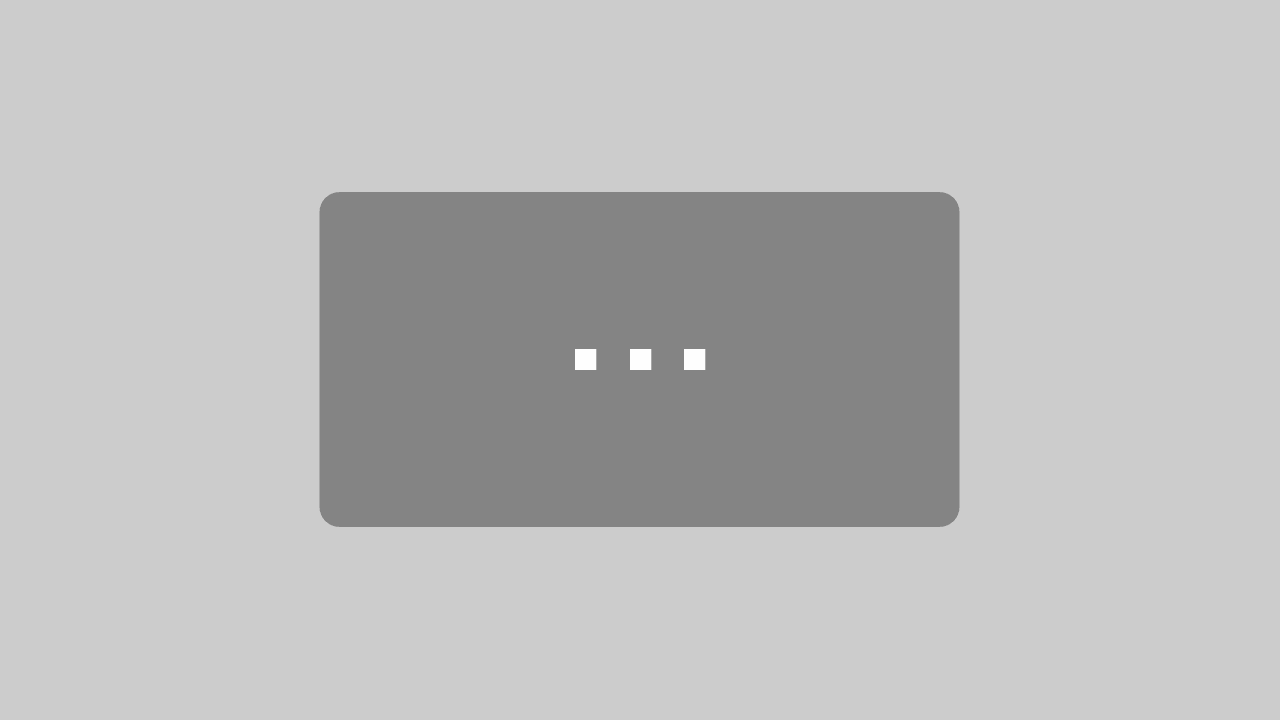



2 comments
Hallo Gunnar,
Es gibt keinen Gegensatz zwischen alter Industriekultur und neuer Shared Economy, wie du in deinem Artikel suggerierst. Im Gegenteil, sie können sich sehr gut ergänzen. Solche Ansätze gibt es schon, vor allem in den Bemühungen zu Industrie 4.0. Dort ist den Entscheidern völlig klar, dass sie sich anpassen müssen. Auch den Politikern und den Professoren in den Universitäten ist das klar. Die entsprechenden Diskussionen zeigen eindeutig und auf einem hohen Niveau, dass die Reise hin zu einer Verschmelzung geht, nicht zu einer Zementierung des Gegensatzes.
Das Problem ist also die mangelnde Anpassung gewachsener Strukturen, und nicht eine grundsätzliche Unvereinbarkeit. Es sind Übergangsschwierigkeiten, die wir gerade haben, aber gelöst werden können. Übrigens: der einzige Grund, warum es den Deutschen im Moment wirtschaftlich gut geht ist, dass wir eine breite industrielle Basis behalten haben. Andere Länder, die das nicht gemacht haben, sind in Schwierigkeiten.
Und noch ein letzter Punkt: die Dinge, die du beklagst, sind wirklich ein Wohlstandsphänomen. Es ist ja nicht falsch, was du sagst, aber das ist ein Witz gegenüber den Anpassungsproblemen gegen Ende des 19. Jhds. oder auch in der ersten Hälfte des 20. Jhds., als beispielsweise die Arbeitsteilung am Band eingeführt wurde. Damals hatten die Leute wirkliche existenzielle Sorgen, und wenn sie einen Job hatten, konnten sie kaum davon leben.
Beste Grüße
Ralf