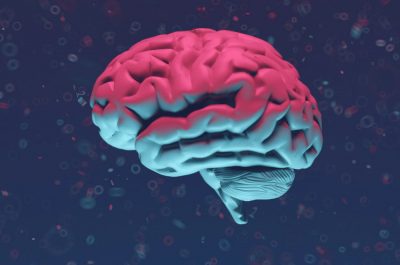„Ruf der Karibik!“
„Ruf der Karibik!“
Alles begann mit Long John Silver. Diese Figur aus dem Roman „Die Schatzinsel“ (Treasure Island) des wunderbaren schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson galt seit seiner Londoner Buchveröffentlichung 1883 als romantischer Inbegriff des Piraten schlechthin: Listig und lustig, einbeiniges Raubein, mit Augenklappe im Gesicht und plapperndem Papagei auf der Schulter, gesegnet mit einem Herz aus Gold. So wie viele Kinder sah ich Byron Haskins erste Filmadaption von 1950 und sog die Mischung aus Abenteuerlust und Südsee tief in meinen Geist ein, träumte davon, ebenso einen unangepaßten, mutigen und schlauen Freund wie Long John Silver zur Seite zu haben.
Das nächste Schlüsselerlebnis hatte ich zur Abiturzeit, beim Drehen meiner ersten Zigaretten, als ich in einem Tabakladen die Marke „Buccaneer“ entdeckte, mit der Zeichnung eines unrasierten Seemanns mit Augenklappe, Perücke und Säbel auf der Packung. Ich orderte den „Buccaneer“, neugierig auf den Whisky darin und den Geruch daran. Ich drehte, rauchte und schmauchte den Buccaneer, bis ich Kopfschmerzen bekam. Es gab noch lange kein Internet und so übersetzte mir das Schulwörterbuch den Begriff „Buccaneer“ lapidar mit „Pirat und Freibeuter“. Was ein Pirat war, wusste ich, doch was meinte das Präfix „Frei“ vor dem „Beuter“? und dann las ich noch ein Comic über Flibustiere. Dieselbe Gegend (Palmen, Riffe, Strand), dieselben Typen (Perücken, Dreispitz, Säbel), aber wieder ein anderer Begriff. Flibustiere. Klingt zoologisch, meint aber vor allem die französischen Piraten, die ab etwa 1625 auf kleinen, aber schnellen und leichten Booten (= frz.: „Flibot“) Raubzüge an den Küsten der Antillen unternahmen und dabei von Bucht zu Bucht schipperten, um ihre Boote rasch in Flussmündungen oder Coves zu verstecken und Proviant aufzunehmen…
Für größere Kaperfahrten wurden aber größere Mengen an Nahrung und Wasser benötigt. Englische und französische Flibustiere schauten sich auf Haiti und Jamaica ein Verfahren zur Konservierung von Fleisch ab, das die indigenen Ureinwohner praktizierten: So wurde auf einem Rost ( = Arawak: „Bukan“ ) bei geringer Glut Fleisch von wilden Ziegen, Rindern oder eingeführten Schweinen langsam gedörrt, dann geröstet, das so trotz tropischer Sonne über lange Zeit nicht verdarb. Nach diesem Verfahren, das Ihnen längere Strecken an Land wie zur See gestattete, nannten die Briten diese neuen Seeräuber „Buccaneers“ = Bukaniere !
Die unterschiedlichen Namen definierten die Seeräuber: So waren Freibeuter im Auftrag für eine Nation unterwegs und Bukaniere für einen lokalen Kommandeur oder Gouverneur. Beide wurden mit offiziellen Kaperbriefen ausgestattet. Mit dem Lateinischen Begriff „Pirat“ (aus dem griechischen peiran = wegnehmen), wurden Seeräuber bezeichnet, die nur unter eigener Flagge und auf eigenes Geheiß segelten und damit von allen Seiten verfolgt wurden. Für die im 17. Und 18. Jh. Krieg führenden Europäer bedeuteten Bukaniere und Freibeuter eine „low – budget“ Variante, um fern der eigenen Gewässer eine Art Guerillakrieg zu führen. Die Freibeuter segelten auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr, bekamen einen Teil der Prise und brauchten in Friedenszeiten nicht weiter versorgt werden. Besonders mit dem spanischen Erbfolgekrieg (1701 – 1715), der zwischen den großen europäischen Mächten geführt wurde und mit seiner weltweiten Ausdehnung auf alle Kolonien als erster Weltkrieg der Geschichte bezeichnet werden kann, füllte sich die Karibik voller Freibeuter und Bukaniersflotten. Aus dieser Ära, die das „Golden Age of the Buccaneers“ bezeichnet, entspringt unser Bild des Piraten. Mit dem Ende des Erbfolgekrieges waren plötzlich hunderte Freibeuter der Karibik arbeitslos: Sie setzten ihre Dienste offiziell Marine oder Handelsmarine fort, wurden sesshaft oder blieben –als Piraten – an Bord ihrer Schiffe. Nunmehr vogelfrei erklärt, wurden sie von den ehemaligen Kriegsparteien vereint gejagt. Kapitäne, die sich trotz Mangel an Nachschub und politischer Unterstützung weiter erfolgreich als Piraten behaupteten , erlangten rasch berüchtigten Ruhm: Blackbeard, Sam Bellamy, Jack Rackham, Edward England und viele Andere, deren Namen, Flaggen und Schiffsnamen bis heute bekannt sind.
Natürlich gab und gibt es Piraten überall auf der Welt, mal von Mythen umwoben wie bei Störtebeker, mal von Makel begleitet wie bei den heutigen Seeräubern. Doch das Bild, welches wir in Europa vom Piraten haben, ist das des karibischen Bukaniers: Als Robert Louis Stevenson mit der Figur des „Long John Silver“ das Motiv des „guten Piraten“ schuf, adaptierte er den Charakter des „Edlen Wilden“, den Daniel Defoe mit Robinson Crueso’s Partner Freitag entwickelte. Der gute Pirat hatte historische Vorbilder: William Dampier (1651 – 1715) , der als Entdecker, Navigator, Kartograph, Autor und Biologe berühmt wurde. Oder Sam Bellamy, der Gentleman – Pirat, der nur aus Treue zu seiner Geliebten zum Bukanier wurde, viele Sklaven befreite, unnötige Gewalt verabscheute und schließlich in einem Sturm 1 Meile vor dem neuenglischen Küstenort seiner Geliebten ertrank. Auch der „böse“ Pirat hat echte Bezüge, die eher kaltblütigen Kapitäne Blackbeard, Bartholomew Roberts oder Emanuel Wynn, der erstmals den Jolly Roger, hisste und die bis heute bekannte Piratenflagge mit gekreuzten Knochen und Schädel entwarf.
Das Genre des Pirtenromans generierte den Piratenfilm. Der böse Captain Hook mit dem Vorbild Blackbeard taucht später bei Walt Disney’s „Peter Pan“ genauso auf wie sein Antagonist in Errol Flynn’s Paraderolle als „Captain Blood“. Spätestens seit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow im Kino – Mehrteiler „Fluch der Karibik“ Millionen Zuschauer weltweit vor die Leinwände bannte, berührt die Welt der Piraten ein Massenpublikum.
Captain Blood, Jack Sparrow oder Long John Silver mit ihren Vorbildern William Dampier oder Sam Bellamy sind stilisierte Figuren, ja Ikonen: Dieser Archetyp des Freibeuters ist dem europäischen Betrachter seit dem „goldenen Zeitalter der Buccaneers“ Mitte des 17. Bis Anfang des 18. Jahrhunderts visualisiert: Zwischen Hochbarock und Rokoko trug der Offizier die Perücke, darüber den Dreispitz. Der Säbel symbolisierte Stand und Führung und funktionierte auch in feuchter Seeluft – im Gegensatz zu Schusswaffen. Ihren Besitz trugen Seeleute in Form von Ringen und Ketten am Körper, denn Geldbörsen wurden verloren, geklaut oder gingen über Bord. Ein Teil der gekaperten Beute wurde als Prise ausgezahlt; Gegenstände aus Gold und Silber wurden noch an Bord zerhackt, geschmolzen und in Ringe, Ketten und Armreife gegossen. So führte keine Spur auf die Herkunft des Edelmetalls und der Seemann hatte in jedem Hafen ein akzeptiertes Zahlungsmittel.
Rum – das braune Gold.
Ein weiteres wichtiges Zahlungsmittel war der karibische Rum besonders der Jamaica – Rum. Autor Dirk Becker hatte bereits in Mixology Nr. 5 / 2010 mit seinem fundierten Beitrag über den „Navy Style Rum“ über die historische Verbindung von Rum und Seefahrt berichtet. Doch welche Rolle spielten dabei die Piraten der Karibik? Ein Blick zurück: Erst mit der Reconquista und der Eroberung Granadas 1492 kamen die Europäer überhaupt in Kontakt mit Rum, doch vermochten sie ihn mangels Kenntnis von Zuckerrohranbau nicht selber herzustellen – im Gegensatz zu den Arabern, welche Rum seit langem in ihren transsaharischen Territorien und den Inseln des indischen Ozeans produzierten. Mit der Expansion nach Westen, ins Mittelmeer und auf die iberische Halbinsel gelang es Ihnen sogar die Kultivierung von Zuckerrohr in weit nördlichere Gebiete.
Mit dem Ende der arabischen Hochkultur verschwand, wie so Vieles, auch die Kenntnis über die Produktion von Zuckerrohr und Rum. Columbus hatte aber, ganz weitsichtig, die letzten Pflanzen nach seiner zweiten Amerikareise Reise 1493 auf Hispaniola eingeführt. Doch erst sehr viel später, über Brasilien und Jamaica, sollte die bis dato einzige Zucker liefernde Pflanze ihren erfolgreichen Anbau in den neuen Kolonien der Europäer beginnen. Ab dem 17. Jahrhundert schließlich entwickelte sich die Idee, in größerem Maße Schnaps aus dem Süßgras zu brennen. Den ersten beurkundeten Hinweis auf den Namen finden wir um 1650 als „rumbullion“ (engl. = Aufruhr, Tumult) und besonders seit dem 8. Juli 1661 von General Edward Doyley, den 1. englischen Gouverneur von Jamaica, welches die Spanier mit der Eroberung von Admiral William Penn 1655 verloren. Ab 1667 wurde der Schnaps offiziell als „Ron“ (kastillisch) bzw. Rhum“ (französisch) bezeichnet.
Jamaica, günstig unter dem Wind gelegen, mit vielen Buchten und Naturhäfen und mitten in der Karibik vergrößerte den englischen Einfluß in der Neuen Welt: Die Kleinste der Großen Antillen war idealer Ausgangspunkt für Kaperfahrten auf spanische und französische Ziele. Während Franzosen und Spanier noch Cognac und Brandy in Eichenfässern in die Karibik transportierten, der schnell verdarb, begannen die Engländer nun mit der Produktion von Rum: Zuckerrohr wuchs überall in den Tropen, ließ sich ganzjährig ernten, gut destillieren und trotz der Hitze einfacher lagern. Rum aus der Karibik entwickelte sich für die britische Krone wie später Gin aus Indien zu einem wertvollen Gut, das auch in Europa erfolgreich verkauft werden konnte. Sowohl Freibeuter wie offizielle Marine zahlten einen Teil der Heuer durch Rationen von Rum aus. Vor allem der ehemalige Kaperfahrer Henry Morgan, (selbsternannter „Chefadmiral aller Bukaniersflotten“ und Verfasser des „Piratencodex“, erst auf Jamaica verhaftet, dann 1674 in London begnadigt und als Gouverneur von Jamaica in den Adelsstand erhoben), führte Rum als offizielles Zahlungsmittel für seine Flotte ein.
Rum als Handelsgut entwickelte sich ab Anfang des 18. Jahrhunderts derart erfolgreich, dass auch Spanier und Portugiesen das Modell kopierten und Rum aus Venezuela, Pánama, Brasilien, Haiti, Puerto Rico und Kuba den Weg nach Europa fand. Zur Hochhaltung der Preise erteilte die britische Admiralität immer mehr Kaperbriefe, um spanische Schiffe aufzubringen und neben Gold und Silber auch die Rumlieferungen nach Europa unter Kontrolle zu bringen. Doch der Plan konnte nicht aufgehen – zu viele Brennereien entstanden, bald auch auf den Kanaren, Kap Verde, den Phillippinen, Sri Lanka und Ecuador sowie im indischen Ozean Madagascar, La Réunion, Mauritius usw.
…das alles war auch für die gewieften englischen Freibeuter nicht zu erobern. So dehnten die Engländer zunächst die Warenpalette tropischer Güter aus: Tabak, Kakao, Kaffee und Baumwolle befüllten die europäischen Häfen und Börsen. Ihre Freibeuter trotzten in zahllosen Scharmützeln immer mehr Boden in der Karibik ab: Belize, Guyana, Barbados, Haiti…Die Plantagenwirtschaft begann und wurde in den sicheren Kolonien der amerikanischen Ostküste erfolgreich fortgeführt.
„Kohle“ an Bord!
Um die flächendeckende Produktion in sengender Hitze zu gewährleisten, benötigten die Händler immer mehr vom wichtigsten Gut: Menschliche Arbeitskraft! Nach dem Genozid an den indigenen Völkern folgte ein neues, trauriges Kapitel europäischer Machtentfaltung in der Karibik: Die Sklaverei! Der Bedarf an billigen Arbeitskräften forderte immer mehr Menschen und setzte den Exodus von Millionen Westafrikanern in Gang. Neben Gold, Silber, Rum und Tabak Fortan konzentrierten sich die verfeindeten Mächte auf das Kapern von Sklavenschiffen. Ein erobertes Sklavenschiff bedeutete Schaden für die gegnerische Produktion und gleichzeitig Arbeitskraft für die eigenen Plantagen.
Hier nehmen die Buccaneere eine besondere Stellung ein, die den Mythos des „guten Piraten“ nachhaltig belebte: Freibeuter und Buccaneere wie der „Gentleman – Pirat“ Sam Bellamy oder der Entdecker William Dampier befreiten die Sklaven geenterter Schiffe und gliederten sie als vollwertige Mitglieder in ihre Mannschaften ein. Gerade die Afrikaner erwiesen sich so als besonders schlagkräftige Bukaniere, voller Haß auf ihre Entführer und besonders loyal zu ihrem Kapitän, denn eine Niederlage auf See endete zwangsweise wieder in der Sklaverei. Sie konnten unter den Freibeuterkapitänen eigenen Besitz mehren und Führungspositionen erreichen.
Ausgerechnet bei den Piraten des 17. und 18. Jahrhunderts fanden verschleppte Afrikaner also erstmals Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – lange vor der französischen Revolution und noch länger vor dem offiziellen Ende der Sklaverei. Denn bei allem Pioniergeist und aller Geldgier wohnte allen Freibeutern derselbe Geist inne:
Der Wunsch nach Selbstbestimmung.
Foto: DugganArt
Erstveröffentlichung in mixology 1/2011
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: Buccaneer, Freibeuter, Pirat