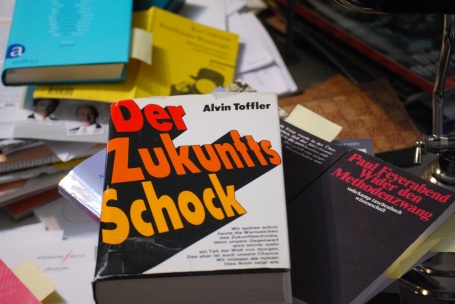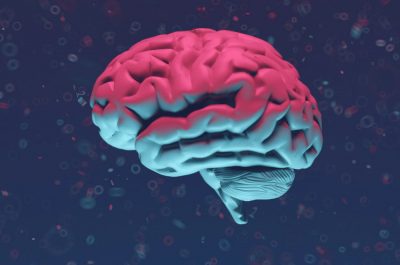„Jedem, der wachen Auges durch das Internet streift, ist die antiintellektuelle Hetze in den Kommentaren vertraut, die sich gegen angeblich Sperriges richtet, gegen kühne Gedanken, gegen Bildung überhaupt. Man lese nur jene höhnischen Nutzerbeiträge, die sich als Wurmfortsatz unter einem typischen Feuilletonartikel finden“, mit diesem Zitat aus dem Zeit-Artikel „Das Netz als Feind. Warum der Intellektuelle im Internet mit Hass verfolgt wird“ von Adam Soboczynski untersuchtKathrin Passig in einem Merkur-Essay die Diskursqualität im Netz und kommt zu einem wenig schmeichelhaften Urteil: „Mir ist kein Ort im deutschsprachigen Internet bekannt, an dem eine konstruktive Kommentarkultur herrscht, und auch befragte Freunde zuckten nur die Schultern. Am ‚Netz als Feind‘ liegt es nicht, denn im englischsprachigen Bereich gibt es Orte, an denen die Kommentare lesenswerter sind als der kommentierte Beitrag“, so Passig. „Sümpfe und Salons“ heißt das Stück…
Man könne den Betreibern von Kommentarforen, Communities und anderen Kommunikationsangeboten höchstens mittelgroße Vorwürfe machen. „Die technischen Voraussetzungen für den Meinungsaustausch mit Menschengruppen, die nicht mehr an einen Kneipentisch passen, gibt es noch nicht lange. Außerhalb spezialisierter Nerdkreise hatte niemand länger als zehn bis fünfzehn Jahre Zeit, um Erfahrungen mit der Förderung und Erhaltung konstruktiver Kommunikation in großen Gruppen zu sammeln. Es ist keine Überraschung, dass zentrale technische wie soziale Probleme ungelöst sind“, führt Passig weiter aus. Wie bei Beziehungen gebe es auch bei neuen sozialen Kreisen eine Phase der Frischverliebtheit, in der sich die Teilnehmer von ihrer besten Seite zeigen. „In den ersten Monaten oder Jahren einer Onlinegemeinschaft befinden sich alle Teilnehmer gleichzeitig in diesem Zustand. Später bildet sich eine phasenverschobene Mischung aus Neuzugängen und Alteingesessenen. Wenn Letztere zu stark überwiegen, legen alle die Füße auf den Tisch, der Diskussionsstandard verfällt, und der Mangel an Nachwuchs führt zu geistiger Stagnation. Eine solche Zombiecommunity kann noch lange weiterexistieren, aber sie ist nur noch eine leere Hülle“, erläutert die Merkur-Autorin. Auch Software, Moderatoren-Systeme, soziale Kontrolle, Rankingverfahren oder sonstige Eingriffe und technischen Tricks gegen Kommentarnichtigkeiten helfen wohl nicht weiter.
Dabei seien doch gerade soziale Netzwerke ideale Orte für herrschaftsfreie Diskurse im Sinne von Jürgen Habermas. So sieht es jedenfalls Stefan Münker in seinem Elaborat „Emgergenz digitaler Öffentlichkeiten“ (edition unseld). „Das Internet hat das technische Potenzial für eine demokratische, partizipatorische Mediennutzung.“ Mit den neuen Medien ändere sich die Kommunikation. Das Publikum stehe nicht mehr unter dem Diktat „Don’t talk back“, wie es bei den klassischen Medien der Fall sei. Denn die seien per se nicht auf eine Interaktion zwischen Sender und Empfänger ausgerichtet. Es sind eben One-to-many-Medien. Das jeder in sozialen Netzwerken nicht nur Empfänger sondern auch Ich-Sender ist, garantiert allerdings noch keine Konversationskunst wie in den Salons der Renaissance oder des Rokoko. Die Qualität oder Quantität der Kommentare in Foren, Blogs oder Portalen ist allerdings auch noch kein Maßstab für die Gesprächskultur (wie sich Social Web und Salonkultur verbinden können, untersuchen die Künstler Antje Eske Kurd Alsleben). Der Salon galt früher als ein Ort, an dem man ungezwungen miteinander umgehen konnte. Er stellte eine zweckfreie und zwanglose Form dar. Als Vorbild für den Netz-Diskurs könnte das dadaistische Cabaret Voltaire in Zürich dienen. Hier ging es vor allen Dingen um den spielerischen Umgang mit den Fragen des Lebens. Ein Dadaist war zugleich Anti-Dadaist. „Sein liebster Zeitvertreib ist es, Rationalisten in Verwirrung zu stürzen, indem er zwingende Gründe für unvernünftige Theorien erfindet und diese Theorien dann zum Triumph führt“, erläutert mein Lieblingsphilosoph Paul Feyerabend in seinem Buch „Wider den Methodenzwang“.
Das einzige, wogegen sich der Dadaist eindeutig und bedingungslos wendet, sind allgemeine Grundsätze, allgemeine Gesetze, allgemeine Ideen wie „die Wahrheit“, „die Vernunft“, „die Gerechtigkeit“, „die Liebe“ und das von ihnen hervorgerufene Verhalten, wenn er auch nicht bestreitet, dass es oft taktisch richtig ist, so zu handeln, als gäbe es derartige Gesetze und als glaube er an sie. Der Dadaist vereint Vernunft und Unvernunft, Sinn und Unsinn, Plan und Zufall – sie gehören als notwendige Teile eines Ganzen zusammen. Denn letztlich ist alles ein Produkt unserer schöpferischen Einbildungskraft und nicht das Ergebnis eines Universums von Tatsachen. Insofern sollte man sich über den allmählichen Verfall von Netz-Gemeinschaften, vom Aufblühen und Verwelken von sozialen Netzwerken überhaupt keine Gedanken machen. Ob Google Plus nun Twitter und/oder Facebook das Leben auspusten wird oder doch alles ganz anders kommt, ist doch völlig egal. Gleiches gilt für saft- und kraftlose Communities.
„Manchmal lassen sich verkrustete Probleme nur durch Neugründung einer Alternative lösen, und nirgends ist das Weiterziehen und Neugründen leichter als im Internet, wo die unbesiedelten Kontinente nie zu Ende gehen. Die Konvektionsbewegung zwischen agilen Neugründungen, erstarrten Imperien, Zerfall und Erneuerung gibt es online wie offline, im Internet sind ihre Zyklen nur kürzer als draußen“, stellt Passig fest.
Vielleicht stamme die Frage, wie sich konkret definierte Gemeinschaften dauerhaft erhalten lassen, noch aus Prä-Internetzeiten, und die von Alvin Toffler 1970 angekündigte Adhokratie hält nicht nur im Beruf, sondern auch in unserem Sozialleben Einzug. Es ginge dann nicht darum, herauszufinden, wie sich das Flüchtige besser zementieren lässt. „Wir müssten kompetenter im Umgang mit veränderlichen sozialen Konstellationen werden, anstatt napfschneckengleich an immer denselben Stellen im Netz klebenzubleiben. Der eingangs erwähnte Intellektuelle ist selbst dafür verantwortlich, nicht dort herumzulungern, wo ihm das Niveau der Auseinandersetzung missfällt“, rät Passig. Das „Wenn’s dir hier nicht passt, dann geh doch nach drüben“, das im staatsbürgerschaftlichen und geopolitischen Raum nur sehr begrenzt funktioniert, sei im Netz ein praktikabler Vorschlag. „Und wenn es das gesuchte Drüben nicht gibt, kann man es immer noch gründen“, resümiert Passig.
Artikel per E-Mail verschicken
Schlagwörter: Intellektuelle, Kultur, Salon, Salonkultur